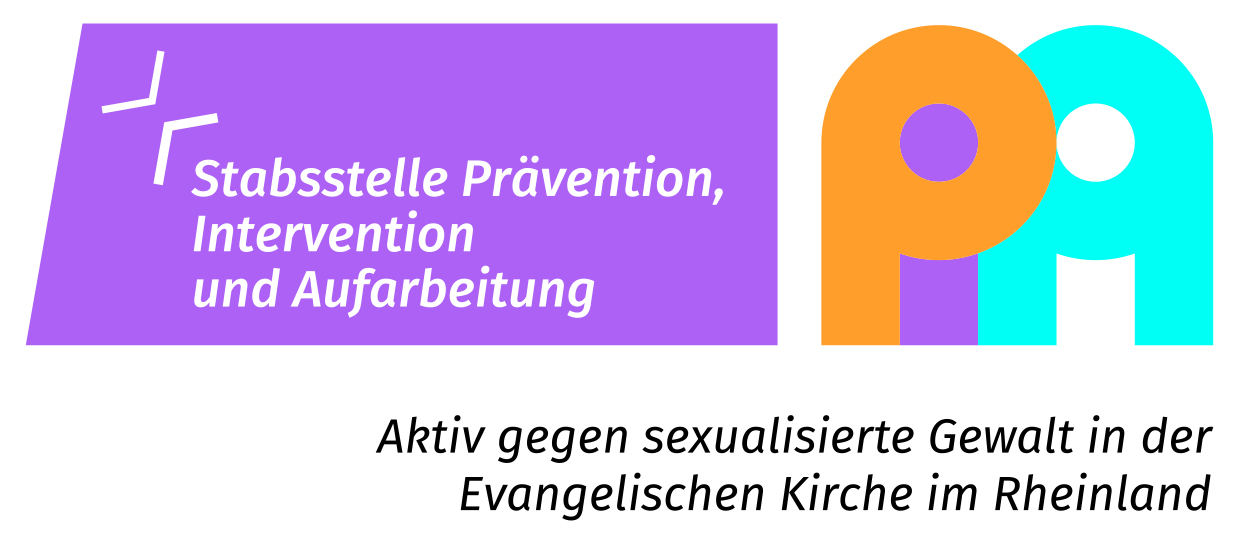Sieben Monate, 7489 Akten: Im Wuppertaler Kirchenkreisarchiv wurden alle Personalakten auf Hinweise sexualisierter Gewalt untersucht. Das Pilotprojekt mit der rheinischen Kirche ist beendet, doch die Aufarbeitung geht weiter.
Sieben Monate lang haben sie insgesamt 24 Stunden in der Woche im Archiv des Wuppertaler Kirchenkreises gesessen und rund 7500 Personalakten auf Hinweise sexualisierter Gewalt durchgesehen. Jede Akteneinsicht wurde dokumentiert und Auffälligkeiten nachgegangen – wie etwa plötzlichen Kündigungen, Beschwerdebriefen oder versteckten Formulierungen, die auf sexuell übergriffiges Verhalten hindeuteten.
„Es war eine mühevolle, aber wichtige und aufschlussreiche Arbeit“, sagt Gudrun Winkels-Haupt, eine der sieben externen Fachkräfte, die am Pilotprojekt Aktenscreening beteiligt waren. Die Rentnerin, die früher die evangelische Familienbildungsstätte in Wuppertal leitete, hat sich schon ihr ganzes Berufsleben lang mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Sie wollte ebenso wie ihre Kollegin Margret Stobbe, die vor ihrer Rente als Leiterin der evangelischen Beratungsstelle der Diakonie Wuppertal tätig war, zur Aufarbeitung beitragen.
„Es war mir immer klar, dass es auch in der evangelischen Kirche sexuellen Missbrauch gegeben hat“, betont Gudrun Winkels-Haupt. „Jetzt stellt sich die Kirche dieser Verantwortung mit einer systematischen Aufarbeitung und dabei wollte ich sie gerne unterstützen.“
Personalakten: früher persönlich, heute formal
Alle Personalakten der unmittelbaren Nachkriegsjahre bis heute haben die beiden Frauen gemeinsam mit vier weiteren Aktenscreenern, darunter drei ehemalige Kripobeamte, in der Hand gehabt. Die Überprüfung der Dokumente erfolgte mit einem Leitfaden der Evangelischen Kirche im Rheinland, der jetzt allen Kirchenkreisen für ihr Aktenstudium zur Verfügung gestellt wurde. „Wir sind uns einig, dass er sehr hilfreich ist. Er entspricht den fachlichen Standards im Umgang mit Fragen sexualisierter Gewalt und stellt sicher, dass alle Aktenscreener die gleichen Kriterien anlegen“, meint Margret Stobbe.
Einig sind sich die Fachleute auch darin, dass sie viel über den Zeitgeist in Kirche und Diakonie lernen konnten: „Je jünger die Personalakte, umso formaler, je älter, umso persönlicher“, erklärt Gudrun Winkels-Haupt. Während es in den Akten seit den 80er Jahren meist nur strukturell notwendige Dokumente wie Arbeitsvertrag und Lebenslauf gab, enthielten die alten Akten viele Notizzettel und persönliche Briefwechsel.
Klare Hinweise auf sexualisierte Gewalt haben die Aktenscreener trotzdem nur in sieben Personalakten gefunden. Sie liegen nun zur Prüfung bei der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie hat unabhängige Staatsanwälte mit der vertieften Sichtung beauftragt. Die Juristen schätzen die Relevanz nicht nur strafrechtlich, sondern auch im Hinblick auf das institutionelle Versagen der Kirche ein.
Akten als „Spiegelbild der Gesellschaft“
Für den früheren Kripo-Beamten Frank Gartmann sind die Akten ein „Spiegelbild der Gesellschaft“, die sich viele Jahrzehnte nicht mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen wollte. Zwar habe es in manchen älteren Akten Hinweise auf ein „unschickliches Verhalten“ von Pfarrern oder Jugendmitarbeitenden gegeben, aber die weitere Recherche sei dann ins Leere gelaufen. „Das wurde bewusst nicht schriftlich festgehalten.“
Superintendentin Ilka Federschmidt sieht in diesem Umgang mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt, was schon in der 2024 veröffentlichten ForuM-Studie kritisiert wurde: „Zu oft fühlte sich niemand letztverantwortlich für die Aufklärung“, sagt sie. „Es fehlte ein klares Leitungshandeln. Wie schon in der ForuM-Studie festgestellt, wurden Betroffene oft im Sinne eines falsch verstandenen theologischen Verständnisses von Vergebung dazu gedrängt, dem Täter zu verzeihen.“
Aus den Fehlern von damals lernen
Die evangelische Kirche, ihre Gemeinden und Presbyterien hätten die Verantwortung, die Rolle derart verdrehter theologischer Motive sowie ihr gelebtes Leitungsverständnis zu hinterfragen und aufzuarbeiten, so Federschmidt weiter. „Wir müssen aus den Fehlern von damals lernen. Das Leid der Betroffenen können wir niemals ungeschehen machen, aber wir können einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sie sich gesehen und in ihrem Leid gewürdigt fühlen.“
Mit dem intensiven Aktenstudium zeige die Kirche, dass sie die Aufklärung sehr ernst nehme, sagt die Superintendentin. „Gleichwohl ist uns bewusst, dass die Akten nur bedingt aussagekräftig sind. Wir brauchen die Mithilfe von Betroffenen, Angehörigen und Zeitzeugen.“ Sie können sich ab Herbst über eine besondere Kontaktadresse an geschulte Mitarbeiterinnen des Kirchenkreises wenden, die entsprechende Hinweise aufnehmen. „Wir bitten ganz ausdrücklich darum, dass sie sich bei uns melden“, betont Superintendentin Ilka Federschmidt. Es werde aber auch an externe, nicht kirchliche Meldestellen verwiesen.
Foto und Text: Sabine Damaschke , Kirchenkreis Wuppertal